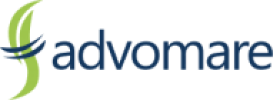Anwalt für Insolvenzrecht: Was muss ich wissen?
Schuldner, die Zahlungen nicht mehr leisten können, riskieren Inkassomaßnahmen oder Zwangsvollstreckung durch Gläubiger. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten und die Schulden steigen weiter.
Die Privatinsolvenz gilt oft als letzter Ausweg, weil das damit einhergehende Vollstreckungsverbot den Schuldner zumindest vor weiteren Maßnahmen seitens der Gläubiger schützt.
Doch ein erfahrener Insolvenzanwalt kann helfen, eine außergerichtliche Einigung zu erreichen, um eine Insolvenz sowie weitere Vollstreckungen zu vermeiden.
Warten Sie nicht, bis die Schulden Ihre Existenz gefährden. Ein Anwalt mit Schwerpunkt Insolvenzantrag kann helfen, Ihre finanzielle Situation durch eine Einigung mit den Gläubigern oder ein Insolvenzverfahren zu klären.
advocado findet für Sie schnell den passenden Anwalt aus einem deutschlandweiten Netzwerk mit über 550 Partner-Anwälten. Dieser kontaktiert Sie innerhalb von 2 Stunden für eine kostenlose Ersteinschätzung Ihrer Handlungsmöglichkeiten.
Was bedeutet ein Insolvenzantrag für Verbraucher?
Wenn ein Verbraucher zahlungsunfähig oder überschuldet ist und einen Insolvenzantrag stellt, folgt das Verbraucherinsolvenzverfahren (Privatinsolvenz).
Vor dem Insolvenzantrag ist es wichtig, einen Schuldenbereinigungsplan zu erstellen. Dieser ist die Grundlage für einen letzten Einigungsversuch mit den Gläubigern über die offenen Forderungen.
Der Tilgungsplan beinhaltet z. B. regelmäßige Zahlungen des Schuldners über einen bestimmten Zeitraum und im Gegenzug den Verzicht der Gläubiger auf einen Restbetrag. Damit wird dem Schuldner am Ende ein wirtschaftlicher Neuanfang ermöglicht.
Ein Anwalt mit Schwerpunkt Insolvenzantrag kann Verbraucher dabei unterstützen, Überblick über ihre Finanzen zu bekommen, einen realistischen Schuldenbereinigungsplan zu erstellen und die Verhandlung mit den Gläubigern übernehmen.
Sind die Gläubiger mit dem Tilgungsplan nicht einverstanden, muss der Schuldner sich das durch einen Anwalt oder Schuldenberater schriftlich bestätigen lassen.
Erst dann kann der Insolvenzantrag gestellt und das Insolvenzverfahren eröffnet werden. Parallel beginnt auch die 3-jährige Wohlverhaltensphase. Der Schuldner muss in dieser Zeit seine pfändbaren Einkünfte an den Insolvenzverwalter abführen – der verteilt sie an die Gläubiger. Außerdem muss der Schuldner gewisse Pflichten erfüllen: z. B. einer Arbeit nachgehen und dem Insolvenzverwalter unverzüglich alle Änderungen bzgl. Arbeitgeber, Einkommen oder Adresse mitteilen.
Am Ende der Wohlverhaltensphase erfolgt die Restschuldbefreiung – wenn diese mit dem Insolvenzantrag direkt beantragt wurde. Wenn der Schuldner seine Verpflichtungen während der Wohlverhaltensphase erfüllt hat, werden ihm die verbleibenden Schulden erlassen.
Die Schuldenfreiheit gilt aber nicht für alle Schulden. Unterhaltsschulden, Bußgelder oder Schulden aus vorsätzlichem Fehlverhalten können von der Restschuldbefreiung ausgeschlossen sein und bleiben bestehen (vgl. § 302 InsO).
Wie stelle ich einen Insolvenzantrag?
Den Insolvenzantrag stellt man beim zuständigen Insolvenzgericht über ein amtliches Formular. Dem Antrag sind weitere Dokumente beizufügen – z. B.:
- Bescheinigung des gescheiterten Versuchs einer Schuldenbereinigung (für Verbraucher, § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO, nach persönlicher Beratung und Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse ausgestellt, z.B. von einem Anwalt)
- Vermögensübersicht und Vermögensverzeichnis
- Gläubiger- und Forderungsverzeichnis
- Schuldenbereinigungsplan
- Antrag auf Erteilung der Restschuldbefreiung
Im Insolvenzantrag müssen Sie Ihre finanzielle Situation offenlegen. Falschangaben oder fehlende Angaben können dazu führen, dass der Insolvenzantrag abgelehnt wird. Ein Anwalt kann Ihren Insolvenzantrag rechtlich absichern und sicherstellen, dass alle Angaben und zugehörigen Dokumente korrekt sind und der Antrag rechtzeitig beim Gericht eingeht.
Insolvenzantrag gestellt: Was nun?
Nach dem Insolvenzantrag sieht der weitere Ablauf des Insolvenzverfahrens in der Regel wie folgt aus:
- Prüfung des Antrags: Der Antrag wird vom zuständigen Insolvenzgericht geprüft und ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, um das Vermögen zu sichern. Der Insolvenzantrag wird abgewiesen, wenn das Vermögen nicht ausreicht, um zumindest die Verfahrenskosten zu decken.
- Eröffnungsbeschluss: Nach Bestätigung der Eröffnungsvoraussetzungen durch das Insolvenzgericht folgt der Erö Das Insolvenzverfahren läuft. Der Insolvenzverwalter übernimmt die Vermögensverwaltung. Die Gläubiger müssen ihre Forderungen für die Insolvenztabelle anmelden.
- Gläubigerversammlung: In der Gläubigerversammlung berichtet der Insolvenzverwalter über das Verfahren. Die Gläubiger können sich informieren und Fragen stellen.
- Vermögensverwertung und Verteilung: Der Insolvenzverwalter verwertet das Vermögen bestmöglich zur Bezahlung der Gläubiger.
- Beendigung des Verfahrens: Am Ende des Insolvenzverfahrens steht die Schlussverteilung des Vermögens an die Gläubiger. Durch einen Aufhebungsbeschluss des Insolvenzgerichts wird das Verfahren beendet.
Eröffnung des Insolvenzverfahrens: Welche Einschränkungen bedeutet das für den Schuldner?
Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens kann unterschiedliche Konsequenzen für den Schuldner haben, beispielsweise:
- Vollstreckungs- und Verwertungsverbot: Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens dürfen Gläubiger keine eigenen Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Pfändungen) gegen den Schuldner mehr einleiten.
- Verfügungsbeschränkungen: Das Vermögen des Schuldners wird vom Insolvenzverwalter verwaltet und verwertet. Der Schuldner darf ohne dessen Zustimmung nicht mehr darüber verfügen.
- Einschränkungen bei Geschäftstätigkeiten: Unternehmen unterliegen geschäftlichen Einschränkungen, z. B. bei Neuverträgen oder Investitionen. Der Insolvenzverwalter überwacht die Geschäftstätigkeit.
- Auswirkungen auf persönliche Haftung: Bei Unternehmen mit beschränkter Haftung (z. B. GmbH) haften die Geschäftsführer womöglich persönlich für Verbindlichkeiten, die nach Eintritt der Insolvenzreife entstanden sind.
- Einschränkungen bei Bankkonten: Die Konten des Schuldners können temporär eingefroren werden, um sicherzustellen, dass Zahlungen kontrolliert und im Rahmen des Insolvenzverfahrens abgewickelt werden.