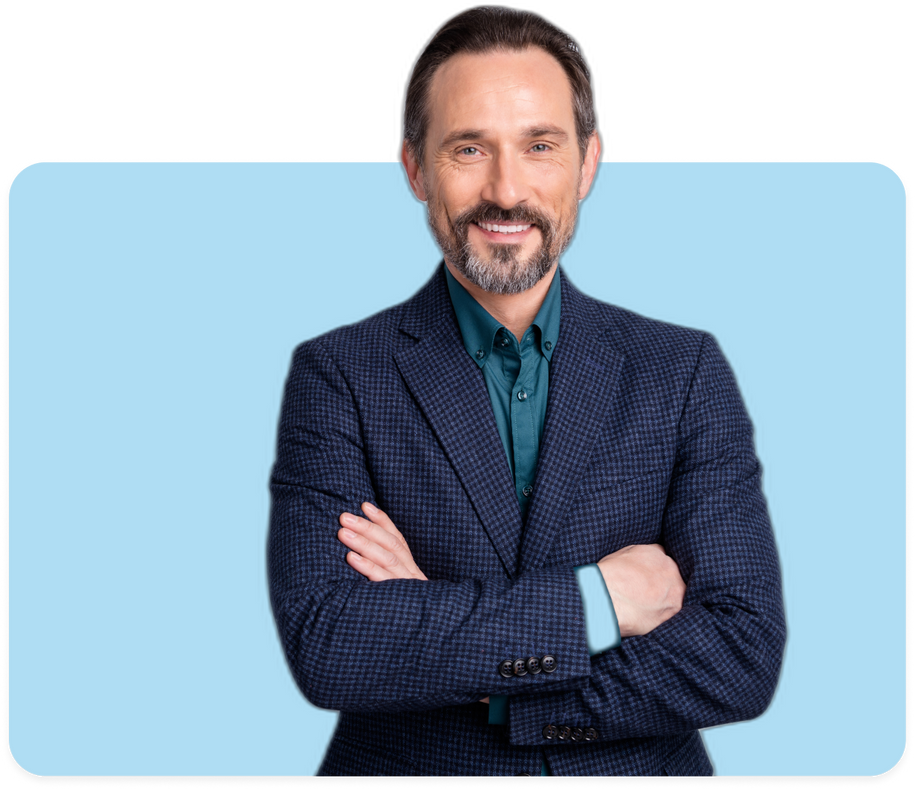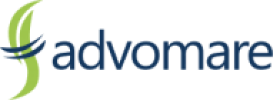1. Kreditkartenbetrug: Wer zahlt den Schaden?
Grundsätzlich haften für den Schaden die Täter des Kreditkartenbetrugs. Da diese jedoch oft nicht ermittelt oder gefasst werden können, stellt sich die Frage, wer stattdessen in Anspruch genommen werden kann. In der Praxis kommen folgende Haftungskonstellationen vor:
- Bank haftet: Erfolgt eine betrügerische Transaktion ohne Ihre Autorisierung, ist die Bank in der Regel verpflichtet, den entstandenen Schaden zu erstatten.
- Kunde haftet teilweise: Haben Sie den Betrug durch leichte Fahrlässigkeit ermöglicht, haften Sie maximal mit 50 Euro. Für darüber hinausgehende Beträge muss die Bank aufkommen.
- Kunde haftet vollständig: Wird Ihnen grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen, müssen Sie den Schaden in voller Höhe selbst tragen.
In vielen Fällen berufen sich Banken schnell auf den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit – oft ohne eindeutigen Beweis für ein Fehlverhalten des Kunden.
Ein auf Kreditkartenbetrug spezialisierter Anwalt kann helfen, solche Vorwürfe zu entkräften und Ihre Ansprüche konsequent durchzusetzen. Zudem bewahrt Sie eine rechtliche Beratung davor, unbedachte Aussagen gegenüber der Bank zu machen, die später zu Ihrem Nachteil ausgelegt werden könnten.
2. Kreditkartenbetrug & grobe Fahrlässigkeit
Ob im Einzelfall grobe oder nur leichte Fahrlässigkeit vorliegt, wird immer individuell beurteilt. Maßgeblich ist, wie ein verständiger Dritter die Situation einschätzen würde:
- Leichte Fahrlässigkeit: „So ein Fehler kann passieren.“
- Grobe Fahrlässigkeit: „Das hätte wirklich nicht passieren dürfen.“
Bei der Bewertung berücksichtigen Gerichte auch persönliche Umstände wie Alter, gesundheitlichen Zustand, Stressfaktoren oder mangelnde Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien.
Beispiel 1: Kreditkartendaten auf einer Fake-Website eingegeben
Werden Kreditkartendaten auf einer erkennbar unseriösen Website eingegeben, kann dies als grob fahrlässiges Verhalten gewertet werden. Merkmale wie fehlerhafte Sprache, fehlende Sicherheitszertifikate oder offensichtliche Designfehler deuten darauf hin, dass der Betrug vermeidbar gewesen wäre. In solchen Fällen darf die Bank die Erstattung des Schadens in der Regel verweigern.
- Leichte Fahrlässigkeit:
Ist die gefälschte Website täuschend echt gestaltet und kaum von einer seriösen Seite zu unterscheiden, sehen Gerichte oft nur leichte Fahrlässigkeit. Die Haftung des Kunden bleibt dann auf 50 Euro begrenzt und die Bank muss den Rest erstatten.
Die juristische Abgrenzung zwischen grober und leichter Fahrlässigkeit ist komplex und hängt stets von den Umständen des individuellen Einzelfalls ab. Daher empfiehlt es sich, einen auf Kreditkartenbetrug spezialisierten Anwalt zu kontaktieren.
Beispiel 2: EC- oder Kreditkarte gestohlen und Konto leergeräumt
Wird ein Konto mit einer gestohlenen Karte und der korrekten PIN belastet, spricht zunächst der Anscheinsbeweis dafür, dass die Transaktion autorisiert war – entweder durch den Karteninhaber selbst, mit dessen Zustimmung oder weil der Kontoinhaber Karte und PIN gemeinsam aufbewahrt hat.
Dieser Anscheinsbeweis kann jedoch widerlegt werden.
Gelingt es dem Karteninhaber plausibel darzulegen, wie Dritte trotz sorgfältigem Umgang mit Karte und PIN Zugriff erlangt haben (z. B. durch Ausspähen der PIN an einem manipulierten Geldautomaten oder Kassenterminal), liegt keine grobe Fahrlässigkeit vor.
In diesem Fall ist die Bank verpflichtet, den Schaden zu erstatten – es sei denn, sie kann konkret nachweisen, dass der Kunde erheblich unachtsam gehandelt hat.
Auch hier empfiehlt es sich, einen auf Kreditkartenbetrug spezialisierten Anwalt einzuschalten. Er kann die Rechtslage klären und prüfen, wer im konkreten Fall darlegungs- und beweispflichtig ist.
3. Was kann ich bei Kreditkartenbetrug tun?
Wenn Sie einen Kreditkartenbetrug vermuten oder feststellen, sollten Sie sofort und in folgender Reihenfolge handeln:
Karte umgehend sperren
Rufen Sie den zentralen Sperr-Notruf 116 116 an (kostenlos in Deutschland) oder wenden Sie sich direkt an Ihr Zahlungsinstitut. Beachten Sie, dass nicht alle Banken am zentralen Sperrdienst teilnehmen – im Zweifel ist der direkte Anruf bei Ihrer Bank die schnellste und sicherste Option.
Verzichten Sie in dieser Situation auf E-Mails oder das Warten auf einen Termin vor Ort – Zeit ist hier der entscheidende Faktor.
Bank informieren
Melden Sie den Betrug unverzüglich Ihrer Bank. Geben Sie jedoch keine vorschnellen oder unnötigen Details preis, bevor Sie sich rechtlich abgesichert haben.
Seien Sie besonders vorsichtig beim Ausfüllen von Formularen oder Fragebögen der Bank: Manche Formulierungen sind so gestaltet, dass sie Ihnen später als Fahrlässigkeit ausgelegt werden könnten.
Strafanzeige bei der Polizei erstatten wegen Kreditkartenbetruges
Kreditkartenbetrug ist eine Straftat und sollte immer der Polizei gemeldet werden. Erstatten Sie zeitnah Anzeige und lassen Sie sich diese schriftlich bestätigen. Diese Bestätigung kann im weiteren Verlauf als wichtiger Nachweis gegenüber Ihrer Bank oder vor Gericht dienen.
Anwalt einschalten
Bei verweigerter Erstattung oder hohen Schadenssummen ist es ratsam, einen auf Kreditkartenbetrug spezialisierten Anwalt zu beauftragen.
Ein erfahrener Anwalt kann die Argumentation der Bank rechtlich prüfen und darlegen, dass allenfalls leichte Fahrlässigkeit vorliegt – in diesem Fall ist Ihre Haftung gesetzlich auf maximal 50 Euro begrenzt oder entfällt sogar vollständig.
4. Welche Arten von Kreditkartenbetrug im Internet gibt es?
Online-Kreditkartenbetrug kann in unterschiedlichen Formen auftreten. Die folgenden Betrugsarten gehören zu den häufigsten:
E-Mail-Phishing
Betrüger versenden täuschend echte E-Mails, die vorgeben, von einer Bank, einem Zahlungsdienstleister oder einem bekannten Unternehmen zu stammen. In diesen Nachrichten finden sich oft Links zu gefälschten Webseiten, die dem Original täuschend ähnlich sehen. Ziel ist es, Empfänger dazu zu bringen, vertrauliche Daten wie Kreditkartennummer, Benutzername oder Online-Banking-Passwort preiszugeben.
Website-Spoofing
Hierbei erstellen Betrüger gefälschte Webseiten, die täuschend echt wie die Login-Seite einer Bank oder eines Zahlungsanbieters aussehen. Nutzer werden dazu verleitet, ihre Zugangsdaten oder Kreditkarteninformationen einzugeben.
Call-ID-Spoofing
Kriminelle rufen ihre Opfer an und fälschen dabei die angezeigte Telefonnummer, sodass diese wie die offizielle Nummer einer Bank erscheint. Am Telefon geben sie sich als Bankmitarbeiter aus und versuchen, das Opfer zur Preisgabe sensibler Informationen zu bewegen.
Smishing - SMS-Phishing
Beim Smishing werden betrügerische Nachrichten per SMS verschickt. Diese enthalten häufig Links zu gefälschten Webseiten oder fordern dazu auf, persönliche Daten direkt per SMS zu übermitteln.
Quishing - QR-Code-Phishing
Beim Quishing werden manipulierte QR-Codes eingesetzt, um Opfer auf schädliche oder gefälschte Webseiten zu leiten. Dort sollen sie persönliche Daten wie Passwörter oder Kreditkarteninformationen eingeben. Diese QR-Codes können in E-Mails, auf Websites, Werbeflyern oder sogar Speisekarten platziert sein.
Phishing über soziale Netzwerke
Betrüger nutzen Plattformen wie Facebook oder LinkedIn, um gefälschte Profile zu erstellen oder über Nachrichten und Posts auf betrügerische Webseiten zu verlinken.
5. Kreditkartenbetrug: So schützen Sie sich wirksam
Einen hundertprozentigen Schutz vor Kreditkartenbetrug gibt es nicht – doch durch umsichtiges Verhalten können Sie das Risiko erheblich reduzieren:
Kreditkartendaten nur an vertrauenswürdige Stellen weitergeben
Teilen Sie Ihre Daten niemals leichtfertig – weder per Messenger, Telefon noch über unsichere Websites. Geben Sie Kreditkarteninformationen nur dann an Dritte weiter, wenn es zwingend erforderlich ist und der Empfänger nachweislich vertrauenswürdig ist.
Abrechnungen regelmäßig prüfen
Kontrollieren Sie jede Buchung auf Ihrem Konto oder Ihrer Kreditkartenabrechnung. Achten Sie besonders auf unbekannte Kleinstbeträge – sie können ein Testversuch von Betrügern sein. Melden Sie Auffälligkeiten sofort Ihrer Bank.
PIN und Karte stets getrennt aufbewahren
Notieren Sie Ihre PIN niemals im Portemonnaie, auf dem Smartphone oder in leicht zugänglichen Dokumenten. Auch scheinbar „verschlüsselte“ Notizen lassen sich oft schnell entschlüsseln. Falls Sie die PIN schriftlich festhalten müssen, bewahren Sie diese sicher zu Hause auf.
Sicherheitsfunktionen der Bank nutzen
Viele Banken bieten Schutzmechanismen wie temporäre Kartensperrungen, Push-Benachrichtigungen bei Transaktionen oder Geoblocking (Sperrung für bestimmte Länder) an. Aktivieren Sie diese Funktionen und prüfen Sie regelmäßig, welche zusätzlichen Sicherheitsoptionen Ihr Anbieter bietet.