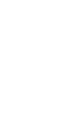1. Klageeinreichung
Der Arbeitnehmer oder sein Anwalt können die Kündigungsschutzklage nebst allen wichtigen Unterlagen beim zuständigen Arbeitsgericht einreichen.
2. Klagezustellung
Nachdem die Kündigungsschutzklage eingereicht wurde, stellt das Arbeitsgericht dem Beklagten, also dem Arbeitgeber, die beglaubigte Abschrift der Klageschrift zu.
3. Güteverhandlung
Arbeitnehmer und Arbeitgeber erhalten die Ladung zur Güteverhandlung. Ordnet das Gericht darin ein persönliches Erscheinen an, müssen beide Parteien am Termin teilnehmen. Ist das nicht der Fall, dürfen sie fernbleiben und einen Vertreter wie einen Anwalt schicken.
In der Regel findet der Gütetermin innerhalb von 2 Wochen nach der Zustellung der Kündigungsschutzklage statt. Ziel des Termins ist, eine gütliche Einigung zu erzielen. Anwesend sind der vorsitzende Richter, ein Vertreter des Arbeitgebers mit Anwalt und der Arbeitnehmer bzw. sein Anwalt.
Einigen sich beide Seiten im Rahmen der Güteverhandlung bereits auf einen Vergleich, akzeptiert der Arbeitnehmer die Kündigung und erhält im Gegenzug oftmals eine frei verhandelbare Abfindung für die Kündigung vom Arbeitgeber. Der Prozess ist damit beendet.
4. Kammertermin
Kommt es in der Güteverhandlung nicht zur Einigung, setzt der Richter einen Kammertermin an. Je nach Auslastung des Gerichts können bis dahin zwischen 2 und 12 Monaten vergehen.
Es handelt sich um eine mündliche Verhandlung, deren Ziel ebenfalls ist, einen Vergleich zu erzielen. Zusätzlich zu den Beteiligten aus der Güteverhandlung sind außerdem zwei ehrenamtliche Richter anwesend – je einer von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite.
5. Beweisaufnahme
Nach einem ergebnislosen 1. Kammertermin kann es zur Beweisaufnahme kommen. Beim 2. Termin werden – wenn vom Gericht als nötig für die Urteilsfindung erachtet – Zeugen vernommen, Sachverständige angehört oder Unterlagen geprüft.
6. Urteil
Mit der Urteilsverkündung entscheidet das Gericht über die Wirksamkeit der Kündigung. Sollten Sie den Kündigungsschutzprozess in der ersten Instanz verloren haben, müssen Sie für eine Berufung im Rahmen der Kündigungsschutzklage Fristen einhalten.
4. Was bewirkt eine Kündigungsschutzklage?
Wird eine Kündigungsschutzklage eingereicht, gibt es 3 mögliche Ausgänge:
Szenario 1: Vergleich
Oft enden Kündigungsschutzverfahren noch vor der eigentlichen Verhandlung. Häufig bieten Unternehmen Mitarbeitern, die die Kündigungsschutzklage zurückziehen, eine Entschädigung an.
Der Mitarbeiter akzeptiert also die Kündigung gegen Zahlung einer Abfindung. Insbesondere Angestellte einer öffentlichen Einrichtung können auf eine Abfindung im öffentlichen Dienst hoffen.
Ein Vergleich kann Vorteile haben:
- Der Arbeitnehmer kann eine Gerichtsverhandlung vermeiden.
- Es fallen keine Gerichtskosten
- Ohne Verhandlung ist der Rechtsstreit schneller beendet.
- Er hat Spielraum, eine überdurchschnittliche Abfindung
- Das Gericht ordnet keine Weiterbeschäftigung an – was für beide Seiten unangenehm sein kann.
- Der Arbeitgeber braucht kein Gehalt nachzahlen für die Zeit der kündigungsbedingten Nichtbeschäftigung. Es wäre bei einer Niederlage fällig.
Szenario 2: Sieg vor Gericht
Ist die Kündigungsschutzklage erfolgreich, weist das Gericht die Kündigung als unwirksam zurück. Der Arbeitnehmer hat gewonnen und das Unternehmen muss ihn jetzt weiterbeschäftigen und ggf. Gehalt nachzahlen. Denn es ist nun so, als ob es nie eine Kündigung gegeben hätte.
In den meisten Fällen ist das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach einem Rechtsstreit aber so zerrüttet, dass eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unzumutbar ist. Das macht oftmals eine angemessene Abfindung möglich.
Szenario 3: Niederlage vor Gericht
Endet der Kündigungsschutzprozess mit einer Niederlage, ist die Kündigung wirksam und das Arbeitsverhältnis beendet. Der Arbeitnehmer muss dann Gerichtskosten und ggf. Anwaltskosten zahlen, sofern ein Anwalt Sie vertreten hat. Ihnen steht keine Abfindung zu.
Arbeitnehmer können beim Landesarbeitsgericht Berufung einlegen, wenn sie mit dem Urteil nicht einverstanden sind. Ab dieser 2. Instanz besteht Anwaltszwang – eine Selbstvertretung ist nicht mehr möglich.
5. Wann ist eine Abfindung bei einer Kündigungsschutzklage möglich?
Arbeitnehmer haben keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Abfindung bei einer ordentlichen Kündigung.
Aber: Ein Anspruch auf Abfindung bei Kündigung besteht bei betriebsbedingter Kündigung. Ein solcher Anspruch kann sich auch aus dem Arbeits- bzw. Tarifvertrag oder einem Sozialplan ergeben. Sie ist zudem möglich, wenn der Arbeitgeber diese freiwillig anbietet oder zu Unrecht kündigt.
Der Arbeitgeber könnte bei einer Kündigungsschutzklage eine Abfindung anbieten, wenn absehbar ist, dass die Kündigung vor Gericht nur geringe Chancen hat. Arbeitnehmer haben dann also eine gute Verhandlungsposition.
Neben der Abfindung kann auch wichtig sein, ein faires Arbeitszeugnis herauszuholen und sonstige Ansprüche wie Bonuszahlungen, Resturlaub, Überstunden, Firmenwagen und Dienstwohnung zu klären.
Weil es für Arbeitnehmer schwer sein kann, eine unrechtmäßige Kündigung oder einen Anspruch auf Abfindung zu begründen, kann ein Anwalt für Arbeitsrecht helfen. Er kennt die Abfindungspraxis vor Gericht und kann beraten, wie sich Ansprüche maximieren lassen.
Für eine Abfindung kann sich die Unterstützung eines Anwalts lohnen: Das Mehr an Abfindung, das er herausholen kann, ist womöglich größer als die Kosten, die dafür anfallen.
 Beitrag von
Beitrag von