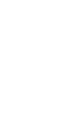Für wen ist eine GbR geeignet?
Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann sich eignen, wenn Sie mindestens zu zweit eine gewerbliche oder auch freiberufliche Tätigkeit ausüben wollen und Sie schnell und ohne hohe Gründungskosten ein Unternehmen aufbauen möchten.
Planen Sie allerdings ein rasantes Wachstum und möchten die Haftung auf das Unternehmensvermögen beschränken, kann eine andere Rechtsformen wie eine GmbH oder UG (Unternehmergesellschaft) besser geeignet sein. Denn bei einer GbR haften alle Gesellschafter unbeschränkt.
Für Startups, die auf Investorensuche sind, kann eine GbR hingegen weniger geeignet sein, denn: Eine GbR hat kein eingelagertes Stammkapital wie beispielsweise eine GmbH und ist daher für Investoren oft unattraktiv.
2. Voraussetzungen für die Gründung einer GbR
Die Voraussetzungen, um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu gründen, sind insgesamt niedrig. Folgende Aspekte müssen GbR-Gründer aber erfüllen:
- Mindestens 2 Gesellschafter
- Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks
- Keine Handelstätigkeit
- Jährlicher Umsatz von unter 250.000 €
Was kostet die Gründung einer GbR?
Eine GbR ist mit niedrigen Gründungskosten verbunden. Die Anmeldung beim Gewerbeamt kostet je nach Region 15 bis 60 € pro Gesellschafter. Startkapital ist bei der GbR-Gründung nicht nötig.
3. GbR gründen: Was muss ich beachten?
Die GbR ist eine Personengesellschaft und unterscheidet sich dadurch hinsichtlich der Haftung, des benötigten Startkapitals und in steuerlichen Gesichtspunkten von Kapitalgesellschaften wie einer GmbH.
Wir haben Ihnen die wichtigsten Fragen rund um die Eigenschaften einer GbR kompakt zusammengefasst:
Wer kann eine GbR gründen?
Sowohl Privatpersonen als auch juristische Personen – d. h. bestehende Personen- und Kapitalgesellschaften – dürfen eine GbR gründen. Daher ist die Gründung einer GbR z. B. auch für Einzelunternehmen möglich.
Wer haftet bei einer GbR?
Der wohl größte Nachteil der GbR ist die persönliche Haftung der Gesellschafter. Sie haften alle unbeschränkt und zu gleichen Teilen mit ihrem Privatvermögen. Das heißt: Kann das Unternehmen Verbindlichkeiten nicht mehr begleichen, müssen die Gesellschafter diese aus eigener Tasche bezahlen. Mit einem Gesellschaftsvertrag ist es jedoch möglich, die Haftung prozentual anders aufzuteilen.
Auch können Gesellschafter mit einem Vertragspartner eine individuelle Haftungsbeschränkung aushandeln – eine allgemeine Haftungsbeschränkung durch die Erstellung von AGB festzulegen, ist allerdings unzulässig.
Wer ist Geschäftsführer in einer GbR?
Wer für die GbR im Innenverhältnis (Geschäftsführung) und im Außenverhältnis (Vertretung) handeln darf, können die Gesellschafter im GbR-Vertrag festlegen. Gibt es keinen Vertrag, müssen alle Gesellschafter gemeinsam als Geschäftsführer einem Geschäft zustimmen müssen.
Ist eine GbR ein Gewerbe?
Eine GbR ist dann ein Gewerbe, wenn die Gesellschafter mit einer selbstständigen und gewerblichen Tätigkeit Gewinn erwirtschaften möchten. Sobald Sie gewerblich tätig sein wollen, ist eine Anmeldung der GbR beim Gewerbeamt erforderlich.
Wie das geht, erfahren Sie in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur GbR-Gründung in Kapitel 5.
Namensgebung der GbR
Bei der GbR-Gründung sind Fantasienamen nur eingeschränkt erlaubt. Das Gewerbeamt, Finanzamt sowie die Industrie- und Handelskammer müssen dem Fantasienamen erst zustimmen.
Die Ämter fordern meist, dass Vor- und Nachname der Gesellschafter sowie der Zusatz „GbR“ im Namen enthalten ist. Beispiel: Max & Monika Musterfrau Kosmetik-Studio GbR.
Wird der Name durch mehrere Mitgesellschafter zu lang (etwa 4 Vor- und Zunamen), können nur die Nachnamen verwendet werden.
Geschäftsführung
Alle Gesellschafter führen die GbR grundsätzlich gemeinschaftlich. Der Abschluss von Verträgen erfordert daher die Zustimmung und Unterschrift aller Gesellschafter. Im GbR-Vertrag lassen sich aber individuelle Regelungen vereinbaren, etwa:
- die Benennung eines einzelnen Geschäftsführers
- eine Mehrheitsregelung für Beschlüsse
- die Erlaubnis für einzelne Mitgesellschafter, Rechtsgeschäfte bis zu einem gewissen Geldbetrag alleine abschließen zu können (z. B. bei der Beschaffung von Büromaterialien)
Jedem Gesellschafter steht immer ein Kontroll- und Informationsrecht zu.
Wie verteilt sich der Gewinn?
In der GbR ist es üblich, dass sich die Gesellschafter ihren Gewinnanteil zu gleichen Anteilen auszahlen lassen. Im GbR-Vertrag können Sie aber auch eine andere Gewinnverteilung festlegen.
Wie wird eine GbR besteuert?
Für eine GbR sind folgende Steuern relevant:
- Umsatzsteuer: Wer Produkte oder Dienstleistungen anbietet, muss Umsatzsteuern an das Finanzamt abführen. Machen Sie im 1. Kalenderjahr weniger als 22.000 € Brutto-Umsatz, können Sie sich durch die sogenannte „Kleinunternehmerregel“ von der Umsatzsteuer befreien lassen (§ 19 Umsatzsteuergesetz).
- Gewerbesteuer: Ist Ihre GbR gewerblich tätig, müssen Sie ab einem jährlichen Gewerbeertrag von mehr als 24.500 € Gewerbesteuer zahlen. Die konkrete Höhe der Steuer ist von der Gemeinde abhängig, in der die GbR angemeldet ist. Freiberufler müssen keine Gewerbesteuer zahlen.
- Einkommensteuer der Gesellschafter: Die GbR selbst muss keine Einkommenssteuer zahlen – aber die Gesellschafter auf ihren Gewinnanteil. Dazu geben sie bei der Steuererklärung an, wie hoch ihre Privatentnahmen aus dem Betriebsvermögen waren.
Buchhaltung der GbR
Für eine GbR ist keine komplizierte Buchführung wie eine Bilanz notwendig – es genügt eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR). Gemäß § 4 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) müssen bei einer EÜR alle erwirtschafteten Umsätze und Gewinne so festgehalten sein, dass sie eindeutig und nachvollziehbar sind.
4. Welche Vor- & Nachteile hat eine GbR?
Eine GbR zu gründen kann den Vorteil sehr niedriger bürokratischer Hürden und günstiger Kosten haben.
Vorteile
- Wenige Gründungsformalitäten
- Sehr niedrige Gründungskosten
- Kein Mindestkapital nötig
- Einfache Buchführung (statt einer umfangreichen Bilanz genügt eine Einnahmenüberschussrechnung)
- Kein Eintrag im Handelsregister, d. h. keine Publizitätspflicht
- Steuerliche Vorteile durch den Status einer Personengesellschaft
- Einfacher Ausgleich von Verlusten mit eigenem Kapital
- Hohes Ansehen bei Banken wegen Haftung der Gesellschafter mit eigenem Vermögen
Nachteile
Den Vorteilen der GbR können folgende Nachteile gegenüberstehen:
- Unbeschränkte Haftung der Gesellschafter mit Vermögen bei Verlusten
- Gründung als Einzelperson nicht möglich
- Durch das fehlende Stammkapital wenig attraktiv für Investoren
- Automatische Umwandlung in eine OHG ab einem Jahresumsatz von mehreren 100.000 € & Eintrag ins Handelsregister
- Einschränkungen in der Namensgebung
Alternativen zur GbR-Gründung
Die passende Rechtsform zu finden, kann ein essentieller Schritt bei einer Unternehmensgründung. Sie schafft die Grundlage Ihres Unternehmens und bringt steuerliche und wirtschaftliche Unterschiede mit sich.
Je nach Unternehmensziel, verfügbarem Eigenkapital und Risikobereitschaft kann sich eine andere Gesellschaftsform wie die Offene Handelsgesellschaft (OHG), Unternehmergesellschaft (UG) oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) anbieten.
Eine UG oder GmbH zu gründen, ist z. B. auch als Einzelperson möglich. Die Haftung beschränkt sich nur auf das Gesellschaftsvermögen. Allerdings ist der Gründungsaufwand relativ hoch, da eine notariellen Beurkundung und ein Eintrag ins Handelsregister notwendig sind. Der Eintrag im Handelsregister macht zudem eine komplizierte, doppelte Buchführung erforderlich.
5. Wie kann man eine GbR gründen? Anleitung in 5 Schritten
Passt die Rechtsform der GbR zu Ihrem Vorhaben, können Sie in 5 Schritten eine GbR gründen:
- Grundsatzfragen klären
- Gesellschaftsvertrag aufsetzen
- Anmeldung beim Gewerbeamt
- Eröffnung eines Geschäftskontos
- Anmeldung beim Finanzamt
Die Anmeldung beim Gewerbeamt ist nur für gewerblich tätige GbR vorgeschrieben. Für nicht gewerbliche GbR und Freiberufler – etwa Ärzte, Hebammen, Künstler, Dozenten oder Ingenieure – entfällt Schritt 3. Sie müssen sich lediglich beim Finanzamt anmelden.
 Beitrag von
Beitrag von