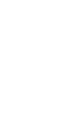Ausführlichere Informationen zum Anspruch auf Schmerzensgeld und wie sich dieser konkret bestimmen lässt, finden Sie in unserem Beitrag zum Schmerzensgeldanspruch.
Wie viel Schmerzensgeld erhalte ich?
Im Gegensatz zum Schadensersatz, bei dem materielle Schäden sich leicht in Geldwerte übertragen lassen, ist die Berechnung von Schmerzensgeld weitaus komplexer.
Entstehen durch einen Auffahrunfall physische oder psychische Schäden, kann der Betroffene gemäß § 253 BGB Schmerzensgeld fordern. Die Entschädigung kann mehrere Hunderttausend Euro betragen. Die Höhe hängt von der Schwere und der Dauer der Beeinträchtigungen ab. Die Ausgleichszahlung wird außergerichtlich mit der Versicherung des Verursachers verhandelt oder gerichtlich festgelegt.
Bei der Berechnung von Schmerzensgeld nach einem Auffahrunfall werden daher verschiedene Faktoren berücksichtigt:
- Ausmaß der physischen & psychischen Folgen,
- Notwendigkeit, Anzahl & Umfang von Operationen,
- Dauer der Behandlung & Krankenhausaufenthalte,
- Auswirkungen auf Alltag & berufliche Situation,
- Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit,
- chronische Schäden,
- Folgeschäden & dauerhafte Entstellungen von Körperteilen,
- willentliche Verzögerung der Schadensregulierung durch die gegnerische Versicherung.
Auffahrunfälle sind zudem häufig eine Kombination aus Fehlverhalten der beteiligten Fahrzeugführer. Somit kann beispielsweise ein fehlender Sicherheitsgurt eine Teilschuld am Schaden begründen – dies muss allerdings umfassend durch einen Gutachter geprüft werden. Erst wenn eine Teilschuld sorgfältig bestimmt wurde, wird diese als Mithaftungsquote anteilig von der Gesamtsumme des Schmerzensgeldes abgezogen.
Beispielurteile
Da die konkrete Höhe von Schmerzensgeld nach Auffahrunfall sich nicht einfach pauschal festlegen lässt, können verschiedene Urteile zu Auffahrunfall-Schmerzensgeldern eine erste Orientierung bieten. Wir haben Ihnen hier drei Beispiele exemplarisch zusammengestellt:
Schädiger haftet nicht für Folgeschäden durch Behandlungsfehler
Bei einer Kindergärtnerin, die als Beifahrerin in einen Auffahrunfall verwickelt ist, treten erst nach einigen Wochen Beschwerden eines Schleudertraumas auf. Der behandelnde Arzt renkt die Halswirbelsäule wieder ein, woraufhin sich die Beschwerden über Monate hinweg verschlimmern und weitergreifende Behandlungsmethoden notwendig werden. Das Gutachten eines Sachverständigen bestätigt, dass die Betroffene durch den Auffahrunfall ein Schleudertrauma erlitt. Der behandelnde Arzt wählte jedoch grob fährlässige Behandlungsmethoden, für deren Schaden der Unfallverursacher nicht haften muss. Der Kindergärtnerin steht nach diesem Auffahrunfall Schmerzensgeld in Höhe von 300 € zu (Oberlandesgericht München (2015), Urteil Az. 10 U 824/14).
Fehlender Sicherheitsabstand führt zu 40-prozentiger Teilschuld
Durch ein riskantes Überholmanöver zwang eine Autofahrerin einen entgegenkommenden LKW-Führer dazu, eine Vollbremsung einzuleiten. Daraufhin fuhr ein Motorradfahrer dem LKW von hinten auf – er hatte den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Folge für den Motorradfahrer ist ein 21-tägiger Krankenhausaufenthalt wegen umfangreicher Knochenbrüche und eine Erwerbsminderung von 30 % durch bleibende Schäden im linken Bein. In naher Zukunft wird eine tiefgreifende Operation des Knies notwendig sein. Allerdings trägt der Motorradfahrer aufgrund seines grob fährlässigen Verhaltens eine Teilschuld von 40 %. Unter Beachtung aller Umstände steht dem Motorradfahrer nach diesem Auffahrunfall Schmerzensgeld in Höhe von 25.000 € zu (Oberlandesgericht Naumburg (2015), Urteil Az. 12 U 58/15).
Langzeitschäden können Schmerzensgeldrente begründen
Ein Beifahrer begutachtet nach einem leichten Auffahrunfall auf der mittleren Autobahnspur den Schaden der betroffenen Fahrzeuge, als ein weiterer Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in die Unfallstelle fährt. Der Beifahrer wird zwischen den ursprünglich beteiligten Fahrzeugen eingequetscht, über 17 Meter weggeschleudert, erleidet multiple lebensbedrohliche Verletzungen und ist fortan zu 100 % erwerbsunfähig und schwerbehindert. Zwar begründet das unerlaubte Betreten der Autobahn ein Mitverschulden in Höhe von 20 %, jedoch steht dem Geschädigte nach diesem Auffahrunfall Schmerzensgeld in Höhe von 250.000 € zu. Zudem hielt das Gericht eine Schmerzensgeldrente von 250 € monatlich als angemessen (Oberlandesgericht Karlsruhe (2013), Urteil Az. 1 U 136/12).
Weitere Beispielfälle sind in sogenannten Schmerzensgeldtabellen zusammengefasst, die ein Verzeichnis mehrerer Schmerzensgeldurteile darstellen. Sie dienen Anwälten und Gerichten als Orientierungshilfe bei der Schmerzensgeldberechnung. Viele weitere Beispiele und ausführlichere Informationen finden Sie in unserem Beitrag zur Schmerzensgeldtabelle. Ausführlichere Informationen zur Höhe des Schmerzensgeldes bei bestimmten Schäden bzw. Verletzungen finden Sie in folgenden Beiträgen:
Wann verjährt mein Anspruch auf Schmerzensgeld?
Wenn Sie nach einem Auffahrunfall Schmerzensgeld geltend machen wollen, gilt gemäß § 195 BGB eine Verjährungsfrist von 3 Jahren. Die Frist setzt am Ende des Jahres ein, in dem es zum Unfall kam und Kenntnis über etwaige Schäden sowie über den Schädiger erlangt wurde. Liegen Unfall und Kenntnisnahme nicht in einem Jahr, so setzt die Verjährungsfrist zum Ende des Jahres ein, in dem Kenntnis erlangt wurde.
Autofahrer A wird im Mai 2017 das Opfer eines Auffahrunfalls, welcher durch einen plötzlichen Spurwechsel von Autofahrer B verursacht wurde. Allerdings begeht Autofahrer B im unübersichtlichen Stadtverkehr Fahrerflucht und wird erst im Februar 2018 polizeilich als Schädiger ausfindig gemacht. Demnach beginnt die Verjährungsfrist am 31.12.2018 und endet Ende 2021.
Sobald nach einem Auffahrunfall Folgeschäden nicht auszuschließen sind, kann bei Gericht auch ein sogenannter Feststellungsantrag eingereicht werden. Dieser sichert den Anspruch aus nicht absehbaren Schäden über die dreijährige Frist hinaus. Doch Achtung: Unabhängig von einer möglichen Verzögerung des Beginns der Verjährung erlischt jeglicher Anspruch auf Schmerzensgeld nach 30 Jahren!
Wer zahlt das Schmerzensgeld?
In der Regel wird das Schmerzensgeld durch die Kfz-Haftpflichtversicherung desjenigen gezahlt, der den Auffahrunfall verschuldet hat. So liegt frei nach der Redensart „Wenn’s hinten knallt, gibt’s vorne Geld!“ grundsätzlich die Schuld beim Auffahrenden, der somit in der Beweispflicht für seine Unschuld ist. Denn die Gerichte (vgl. Kammergericht Berlin, Az. 22 U 72/13) gehen davon aus, dass der auffahrende Fahrzeugführer vor dem Auffahrunfall
- unaufmerksam oder abgelenkt war,
- den notwendigen Sicherheitsabstand missachtete oder
- die ordnungsgemäße Geschwindigkeit nicht eingehalten hat.
Erst bei einem Nachweis, dass das Verhalten des Vorausfahrenden den Unfall verursachte, kann der auffahrende Fahrzeugführer Schmerzensgeld nach Auffahrunfall verlangen. Das sind beispielsweise vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Verkehrsregeln wie
- das Nichteinschalten der Warnblinkanlage bei Stauende,
- plötzliche Fahrspurwechsel,
- eine unbegründete Vollbremsung oder
- die absichtliche Provokation einer Gefahrensituation.
Wie Sie nach einem Auffahrunfall Schmerzensgeld durchsetzen, was dabei zu beachten ist und welche Hürden auftreten können, erfahren Sie im nächsten Kapitel.
2. Nach einem Auffahrunfall Schmerzensgeld geltend machen
Um nach einem Auffahrunfall Schmerzensgeld vom Verursacher einzufordern, können sich zunächst auf außergerichtlichem Wege an die gegnerische Versicherung gewendet werden. Sollte es hier zu keiner Einigung kommen, muss das Schmerzensgeld nach Auffahrunfall gerichtlich eingeklagt werden.
Außergerichtliche Einigung
Für eine außergerichtliche Einigung mit der gegnerischen Versicherung ist zunächst ein Schmerzensgeldantrag an diese zu stellen. Das formlose Anschreiben sollte folgenden Inhalt haben:
✓ Anschrift (Unfallopfer),
✓ Anschrift der gegnerischen Versicherung,
✓ Name des Schädigers,
✓ Anliegen (Antrag auf Schmerzensgeld vom Schädiger an den Geschädigten),
✓ Mithaftungsquote des Geschädigten,
✓ Einschätzung über ein angemessenes Schmerzensgeld,
✓ Fristsetzung für dessen Auszahlung.
Um Schäden und deren Ursache nachzuweisen, bieten sich folgende Dokumente an:
✓ ärztliche Behandlungsakten,
✓ Krankschreibungen,
✓ Arzt- und Krankenhausrechnungen,
✓ detaillierte Aufzeichnungen zum Heilungsverlauf mit Fotos,
✓ Gutachten zum Umfang der verminderten Erwerbsfähigkeit,
✓ Nachweise über die Ursachen der Schäden.
Die gegnerische Haftpflichtversicherung wird ggf. nicht ohne Vorbehalte auf Ihre Forderung eingehen. So kann z. B. bei Auffahrunfällen, welche bei einer Geschwindigkeit von unter 10 km/h stattfanden, eine sogenannte „Bagatellgrenze“ geltend gemacht werden. Diese bezeichnet einen Schwellenwert, unter diesem vermeintlich keine wesentlichen Verletzungen entstehen können.
 Beitrag von
Beitrag von