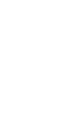1. Wann kann ich meinen Arzt verklagen?
Möglichkeiten, die eigenen Rechtsansprüche geltend zu machen, gibt es dennoch. Insbesondere dann, wenn der Arzt seiner Sorgfaltspflicht nicht nachkommt und eine Fehldiagnose stellt, falsch behandelt, Hilfeleistung unterlässt oder fehlerhaft aufklärt. Wehrt sich der Patient gegen einen solchen Arbeitspfusch, welcher das eigene Wohlbefinden beeinflusst, so muss sich der jeweilige Arzt straf- oder zivilrechtlich behaupten und kann auf Schmerzensgeld oder Schadensersatz verklagt werden.
Bevor es jedoch zur Klage kommt, kann die Regel helfen: Suchen Sie das Gespräch! Eine ärztliche Behandlung ist letztlich nichts anderes als eine Vertragsvereinbarung. Das medizinische Recht setzt keinen schriftlich aufgesetzten Vertrag voraus, dennoch kommt solch ein Dienstvertrag bereits zustande, wenn der Patient die Arztpraxis betritt. Das erlaubt dem Patienten, kritische Nachfragen zu stellen und sich über die Vorgehensweise der Behandlung genauestens informieren zu lassen. Bei tatsächlichem Ärztepfusch kann ein Anwalt dabei helfen, die Beweise für einen erfolgreichen Prozess gegen den Arzt zu sammeln.
Die Patientenakte verrät in der Regel alles über die durchgeführte Behandlung und dient daher als das wichtigste Beweismittel im Prozess. Ein Anwalt kann dabei helfen, Einsicht in diese Patientenakten zu bekommen und die Herausgabe der Akte zu veranlassen. Anhand der Akte lassen sich auch mögliche Prognosen bezüglich der Aussicht bei einem Prozess ermitteln.
Sofern sich die Gesundheit des Patienten nicht verbessert oder sogar noch verschlechtert, kann geprüft werden, ob es sich an dieser Stelle um Ärztepfusch handelt und ob der Arzt dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann. Grundsätzlich gilt jedoch, dass ein Arzt nicht für eine Heilung an sich verantwortlich ist. Hier geht es ausschließlich um sein Bemühen um die Heilung. Ein Arzt kann also nicht verklagt werden, wenn er richtige Maßnahmen ergreift, diese jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis führen.
2. Privileg für Patienten: die Patientenrechte
Am 26. Februar 2013 trat ein Gesetz in Kraft, welches die Rechte von Patienten schützen soll, die etwa einen Behandlungsfehler beim Arzt erlitten haben. Das Patientenrechtgesetz – wörtlich „Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten“ – umfasst drei grundlegende Bereiche:
- das Recht auf Einsehen der Behandlungsunterlagen,
- das Recht auf Aufklärung und ausführliche Informationen,
- das Recht auf die eigene Selbstbestimmung, wonach beispielsweise eine medizinische Behandlung oder ein Eingriff nur mit Einwilligung des Patienten erfolgt.
Grundlegend basiert dieses Gesetz auf dem § 630a BGB. Dort werden die allgemeinen Rechte und Pflichten – die gleichsam den Behandelnden und den Behandelten betreffen – festgehalten. Zum Beispiel ist jeder Arzt (aber auch jeder Heilpraktiker, Therapeut o. ä.) dazu verpflichtet, seinen Patienten umfassend aufzuklären und zu informieren. Das betrifft sowohl die Behandlung als auch die Risiken und möglichen Erfolge. Der Patient muss für jeden Eingriff seine Einwilligung geben. Möglich ist auch, dass eine entsprechende Patientenverfügung vorliegt. Alle Befunde sowie möglichen Schritte müssen in einer Patientenakte niedergeschrieben werden. Verstößt ein Arzt gegen diese Regelungen und schadet damit seinem Patienten, so kann der Patient den Arzt verklagen und hat in der Regel einen Anspruch auf Schadensersatz und Schmerzensgeld.
Mit diesem umfassenden Gesetz sollen die allgemeinen Rechte von Patienten verbessert und transparenter werden. Denn nur, wer seine eigenen Rechte kennt, kann davon auch Gebrauch machen.
3. Die Aufklärungspflicht der Ärzte
Jeder Arzt ist dazu verpflichtet, seine Patienten genauestens über die beabsichtigte Behandlung zu informieren. Dazu gehören auch die mit der Behandlung einhergehenden Risiken und möglichen Erfolgsaussichten. Das wird umfassend als Aufklärungspflicht beschrieben und ist deshalb zwangsläufig notwendig, weil ein ärztlicher Eingriff im eigentlichen Sinne Körperverletzung bedeutet. Indem jedoch der Patient der Behandlung zustimmt, bleibt der Arzt straffrei. Für solch eine Zustimmung jedoch muss der Patient ausführlich informiert und aufgeklärt sein.
Kommt ein Arzt seiner Aufklärungspflicht nicht nach, macht er sich strafbar. Zudem gilt der Grundsatz: Je umfangreicher und größer die durchgeführten Maßnahmen, desto ausführlicher muss der Patient auch aufgeklärt werden.
4. Arzt verklagen bei Fehldiagnose
Im Gegensatz zu einer falschen Behandlung kann es bei einer Fehldiagnose weitaus schwieriger sein, den Arzt zu verklagen und die eigenen Ansprüche vor Gericht geltend zu machen. Denn hier liegt die Beweislast beim Patienten selbst, Fehldiagnosen werden nur selten als Behandlungsfehler eingestuft. Gleichsam sinkt damit auch das Risiko, Schmerzensgeld zu bekommen. Ausgeschlossen ist das jedoch nicht: Wer seinen Arzt wegen einer Fehldiagnose verklagt, hat dennoch Chancen auf Entschädigung. Hat etwa die falsche Diagnose zu starken Sorgen und Ängsten beim Patienten geführt, kann dieser Schmerzensgeld einfordern. Das Oberlandesgericht Bamberg sprach einem Betroffenen 2.500 € zu, der die Diagnose „dringender Verdacht auf Hodenkrebs“ erhielt, welche sich letztlich als falsch herausstellte (Az. 4 U172/02).
Wer einer Fehldiagnose selbst vorbeugen und damit auch das Verklagen des Arztes umgehen möchte, der kann selbst vorsorgen. Es bietet sich immer an, sämtliche Symptome schriftlich zu notieren, die am eigenen Körper festgemacht werden können. Je mehr Informationen der Patient selbst liefern kann, desto mehr ist auch dem Mediziner geholfen.
5. Arzt verklagen wegen falscher Behandlung
Dafür muss an erster Stelle unterschieden werden, ob es sich beim davongetragenen Schaden um einen groben oder einfachen Behandlungsfehler handelt:
- Der grobe Behandlungsfehler liegt vor, wenn der Arzt gegen die allgemeinen Behandlungsregeln verstoßen und damit einhergehend medizinische Erkenntnisse ignoriert oder außer Acht gelassen hat. Aus neutraler Sicht kann die Handlungsweise des Arztes bei einem groben Behandlungsfehler nicht mehr nachvollzogen werden und hätte in dieser Form nicht in der gängigen Praxis geschehen dürfen. Liegt solch ein Fehler vor, so muss der Arzt bei einer Klage nachweisen können, dass die Schuld nicht bei ihm liegt.
- Der einfache Behandlungsfehler betrifft alle Fälle, die nicht in die Kategorie der groben Behandlungsfehler fallen. Dann hat der Arzt etwa seinen Patienten nicht sorgfältig genug behandelt, der Patient trägt an dieser Stelle jedoch die Beweislast.
Der Unterschied zwischen diesen falschen Behandlungen ist das Tragen der Beweislast, was für den Patienten besonders wichtig sein kann, wenn er den eigenen Arzt verklagen will: Im ersten Falle muss der Arzt beweisen, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen seiner Behandlung und dem geschädigten Patienten, bei einem einfachen Behandlungsfehler jedoch muss der Patient beweisen, dass der Arzt einen Fehler begangen hat.
6. Arzt verklagen wegen unterlassener Hilfeleistung
Die unterlassene Hilfeleistung führt immer wieder dazu, dass es zu einer gerichtlichen Verhandlung und damit einhergehenden Ermittlung gegen Ärzte kommt. Diese Pflicht der Ärzte ist im § 323c StGB festgehalten: Demnach unterliegt jeder Bürger in Deutschland der Pflicht der allgemeinen Nothilfe und muss seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechend Hilfe leisten. Da Ärzte jedoch im Allgemeinen die Einzigen vor Ort sind, die in hohem Maße wirksame Hilfe leisten können, sind sie von diesem Gesetz besonders betroffen.
Hilfe zu leisten hat Jedermann immer dann, wenn ein Unglücksfall besteht oder sich eine Krankheit akut verschlimmert. Dann sind die besonderen Fähigkeiten des Arztes gefragt: Er muss all jene Maßnahmen ergreifen, die zur Besserung des Zustandes des Betroffenen beitragen oder die Schäden wirksam abzuwenden. Kommt ein Mediziner dem nicht nach, so kann der Arzt wegen unterlassener Hilfeleistung verklagt werden und der Betroffene Schmerzensgeld oder Schadensersatz fordern.
So wurde im Jahr 2010 in Gießen beispielsweise ein Allgemeinmediziner zu 3.000 € Schmerzensgeld verklagt (Az. 21 K 3235/09.GI. B). Eine Frau kontaktierte einen zum Notdienst eingeteilten Arzt aufgrund akuter Übelkeit und wurde daraufhin in seine Praxis bestellt. Als die Patientin jedoch an der Praxis ankam und klingelte, öffnete der Arzt die Tür nicht. Angehörige fuhren die Betroffene in ein Krankenhaus, in dem ein schwerer Herzinfarkt diagnostiziert wurde. Die Frau verstarb wenige Stunden später. Der Mediziner hat an dieser Stelle gegen seine Berufspflicht verstoßen. Er beteuerte jedoch, dass er die Klingel nicht gehört habe.
Geprüft werden muss in jeder Situation auch, inwiefern der Arzt überhaupt helfen konnte. Musste er dabei auf seinen eigenen Schutz achten? Waren die Möglichkeiten einer potentiellen Patientenaufnahme im Krankenhaus erschöpft? All jene Aspekte können eine wichtige Rolle spielen.
7. Arzt verklagen & Schmerzensgeld erhalten
Immer wieder wird in den Nachrichten von Fällen aus den USA berichtet, in denen betroffene Patienten ihren Arzt verklagt und horrende Summen an Schmerzensgeld erhalten haben. So nahm beispielsweise ein Patient ein Handy mit Aufnahmefunktion mit in eine Praxis in Reston (Virginia), in der bei ihm eine Darmspiegelung durchgeführt wurde. Nach der durchgeführten Behandlung spielte der Mann das Band ab: Das Behandlungsteam beleidigte den Mann in erheblichem Maße, sprach von möglichen Gewaltakten am Patienten und falschen Diagnosen, die sie in die Patientenakte schreiben würden. Die Behandelnden wurden wegen Verleumdung und Amtsmissbrauch verklagt, dem Geschädigten wurden eine halbe Million Dollar Schmerzensgeld zugesprochen.
Solche Summen kommen in Deutschland eher selten vor. In einem weiteren medizinischen Fall wurde einer Frau die Brust amputiert, die jedoch erhalten hätte werden können. Denn der Arzt hatte bestimmte Diagnosemaßnahmen unterlassen. Dafür erhielt die Frau 30.000 € Schmerzensgeld. Nachweisbar waren die durchgeführten Maßnahmen aufgrund der in der Patientenakte festgehaltenen Schritte (OLG Düsseldorf, Az. 8 U 22/02).
Auch wenn die beiden aufgeführten Fälle gänzlich unterschiedliche Schäden aufzeigen, so haben beide eines gemeinsam: Die Betroffenen haben von ihrem Recht Gebrauch gemacht und den Arzt auf Schmerzensgeld verklagt. Beide hatten Beweismaterial, um ihre Aussagen zu stützen.
Jeder medizinische Fall ist ein Einzelfall, die Höhe des Schmerzensgeldes hängt daher von vielen Umständen ab. Dazu zählen etwa die Schwere des entstandenen Schadens und mögliche Folgeschäden. Eine Orientierung bietet jedoch die Schmerzensgeldtabelle. Diese gibt an, wann einem Betroffenen Schmerzensgeld in welcher Höhe zustehen könnte.
8. Wie kann ich am besten vorgehen?
Patienten stehen vor großen Problemen: Sie selbst sind oftmals nicht in der Lage, objektiv zu beurteilen, ob sie medizinisch falsch behandelt wurden. Deswegen gibt es in Deutschland verschiedene Stellen, die Betroffenen weiterhelfen:
- Das ist an erster Stelle der behandelnde Arzt selbst: Auch, wenn es dem Patienten schwerfallen mag, so kann mit dem Arzt das Gespräch gesucht werden. Wer da nicht weiterkommt, kann sich an höhere Instanzen wenden wie etwa die Leitung der Klinik oder die dort ansässigen Beschwerdestellen.
- Erste Fragen über die eigenen Rechte und Pflichten können bei verschiedenen Verbraucherzentralen, Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen gestellt werden. In der Regel bieten diese Stellen auch kostenlose Beratungstelefone an.
- Ärztekammern bieten Hilfe außerhalb des Gerichts. Sie verfügen über Gutachter und Schlichtungsstellen und sind zudem kostenlos. Der Knackpunkt könnte aber sein: Hier urteilen Ärzte über die Arbeit anderer Ärzte, dabei geht es ausschließlich nach der Patientenakte.
- Eine Anlaufstelle bieten auch Krankenkassen über den Medizinischen Dienst. Dort sind ebenfalls eine Beratung und das Einholen eines Gutachtens außerhalb des Gerichts möglich. Auch hier wird den betroffenen Patienten kostenlos geholfen.
- Ihre Rechte genauestens im Blick hat ein Anwalt. Dieser berät den Patienten über Vorgehensweisen und Möglichkeiten und geht den Weg gemeinsam mit Ihnen, um den Arzt zu verklagen und Schadensersatz oder Schmerzensgeld geltend zu machen.
Wichtig kann außerdem sein, dass sich jeder Patient über seine möglichen Ansprüche und Rechte bewusst ist, wenn er seinen Arzt verklagen will:
- So muss jeder Arzt seine Patienten stets sorgfältig und seinen ärztlichen Fähigkeiten entsprechend behandeln. Kann das nicht garantiert werden, muss eine Überweisung an einen anderen Arzt erfolgen.
- Der Arzt muss seiner Aufklärungspflicht nachkommen und den Patienten über Risiken, zu erfolgende Maßnahmen sowie die Erfolgsaussichten informieren. Dazu kann auch (wenn möglich) gehören, verschiedene Behandlungsmethoden vorzuschlagen. Der Patient hat das Recht, Behandlungen abzulehnen.
- Hat der Patient dennoch das Gefühl, falsch behandelt worden zu sein, so hat er oder eine beauftragte Vertrauensperson einen Anspruch auf die Einsicht in alle ihn betreffenden Dokumente. Auch Kopien können angefordert werden, die der Patient selbst bezahlen muss.
- Achtung: Fristen einhalten! Wer seinen Arzt verklagen will, der muss die Verjährungsfrist von 3 Jahren beachten. Diese für den Regelfall gesetzte Frist beginnt, sobald der Patient die Vermutung einer Fehldiagnose oder falschen Behandlung äußert.