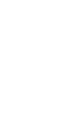2. Die Wechselmodell-Klage
Dass ein Wechselmodell auch gegen den Willen eines Elternteils eingeklagt werden kann, entschied 2014 erstmalig das Amtsgericht Heidelberg. Bis dahin wurde keine solche Klage zugelassen. Drei Jahre später schloss sich der Bundesgerichtshof dieser Entscheidung an. Welche Hintergründe bei diesen beiden Entscheidungen wichtig sind, erfahren Sie jetzt.
Rechtsprechungen zum Wechselmodell
Am 19.08.2014 entschied das Amtsgericht Heidelberg, dass man das Wechselmodell einklagen kann (AZ: 31 F 15/14). Hier hatte ein Vater zweier Kinder auf das Wechselmodell geklagt. Folgende Ausgangslage war gegeben:
- Die Eltern lebten unehelich zusammen.
- Nach der Trennung entschieden sie sich für ein Wechselmodell im 2-2-5-5-Tage-Rhythmus.
- Nach einiger Zeit wollte die Mutter zum Residenzmodell zurückkehren – Kinder sind dabei lediglich alle zwei Wochenenden beim Vater.
- Der Vater klagte auf Weiterführung des Wechselmodells mit einem wöchentlichen Wechsel.
Ein wegweisendes Urteil zur Wechselmodell-Klage fällte zudem der BGH am 01.02.2017. Ein Kindsvater hatte einen Antrag zur hälftigen Beteiligung an der Betreuung seines 13-jährigen Sohnes gestellt. Die Mutter weigerte sich jedoch, diesem zuzustimmen. Das OLG (Oberlandesgericht) Nürnberg gab der Mutter vorerst Recht und wies den Antrag zurück – mit der Begründung, dass eine gerichtliche Anordnung des Wechselmodells nicht rechtens sei.
Der BGH widerlegte dieses Urteil folgendermaßen:
„Eine gerichtliche Umgangsregelung, die im Ergebnis zu einer gleichmäßigen Betreuung des Kindes durch beide Eltern im Sinne eines paritätischen Wechselmodells führt, wird vom Gesetz nicht ausgeschlossen.“
Ausschlaggebend war zudem, dass der Sohn des Mandanten vom OLG Nürnberg nicht zur Thematik befragt wurde. Diese Befragung wurde vom BGH nachgeholt – der Sohn erklärte sich dabei mit dem Wechselmodell einverstanden.
Mit diesem Urteil hat der BGH den Grundstein dafür gelegt, dass Eltern das Wechselmodell einklagen können – auch gegen den Willen des anderen Elternteils. Dieses Urteil bedeutet jedoch nicht, dass das Wechselmodell bei einer Klage zwangsläufig angeordnet wird. Ob der Klage auf ein Wechselmodell stattgegeben wird, entscheiden die zuständigen Gerichte je nach individueller Ausgangslage.
Voraussetzungen für eine Wechselmodell-Klage
Um das Wechselmodell einklagen zu können, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein:
- Der Wunsch und das Wohl des Kindes stehen an erster Stelle,
- es sind genügend finanzielle Mittel für zwei kindgerechte Wohnungen vorhanden,
- die Betreuung des Kindes innerhalb der Woche ist trotz der Berufstätigkeit der Eltern möglich und
- ein Mindestmaß an Absprache zwischen den Eltern ist gewährleistet – ansonsten ist zu viel Konfliktpotential gegeben.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann man das Wechselmodell einklagen. Ob das Gericht dann auch zugunsten des Klägers entscheidet, ist durch Erfüllung der Voraussetzungen allerdings nicht gewährleistet. Deswegen sollten Sie im Vorhinein gut abwägen, ob eine Klage sinnvoll ist.
Im Rahmen dieser Klage ist eine Schrittfolge zu beachten, die wir Ihnen im nächsten Kapitel vorstellen.
3. Wie kann ich das Wechselmodell einklagen?
Um das Wechselmodell einzuklagen, kann folgende Schrittfolge eingehalten werden. Wird diese nicht berücksichtigt, kann dies dazu führen, dass die Klage entweder abgewiesen wird oder keinen Erfolg hat.
- Zunächst ist ein Schriftstück aufzusetzen, in dem die Anordnung eines Wechselmodells gefordert wird. Dieses wird an das zuständige Amtsgericht gesendet. Ist dieses nicht stichhaltig und fundiert oder nicht rechtssicher aufgesetzt, stehen Ihre Chancen schlecht. Für diesen Schritt sollten Sie deswegen einen Rechtsexperten hinzuziehen, der Sie von Anfang an bei der Klage unterstützt.
- Das Amtsgericht informiert alle Beteiligten – meist den anderen Elternteil, das Jugendamt und einen Verfahrensbeistand – über die Forderung und bittet um Stellungnahme. Diese muss innerhalb einer festgelegten Frist – meist 14 Tage – beim Amtsgericht eingereicht werden.
- Innerhalb der Frist können sich Verfahrensbeistand und Jugendamt ein Bild von der Situation machen und eine Stellungnahme abgeben – der Antragsgegner kann in dieser Zeit ebenfalls ein Schriftstück aufzusetzen, um den Antrag abzuweisen.
- Nach Eingang aller Unterlagen werden diese vom Amtsgericht geprüft und alle Beteiligten zur Anhörung geladen.
- Bei der Anhörung werden alle Beteiligten zur Situation befragt – eine Entscheidung wird hier meist jedoch noch nicht gefällt.
- Die betroffenen Kinder werden von den Richtern befragt – meist in einem Gespräch außerhalb der Anhörung.
- Weitere Beweiserhebungen können stattfinden. Kommen Richter aufgrund der vorliegenden Informationen zu keiner Entscheidung, werden Sachverständigengutachten, Mediation oder andere Maßnahmen zur Klärung angeordnet.
- Einige Wochen nach dem letzten Anhörungstermin wird die richterliche Entscheidung postalisch an alle Prozessbeteiligten zugestellt.
- Ist man nicht einverstanden mit der Entscheidung, kann Beschwerde vor dem zuständigen Oberlandesgericht eingelegt werden.