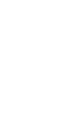Frist einhalten
Wer die Vaterschaft anfechten möchte, hat dazu zwei Jahre ab dem Tag Zeit, an dem er Kenntnis darüber erlangt oder Grund zur Annahme hat, dass er nicht der Vater des Kindes ist. Diese Anfechtungsfrist beginnt erst mit der Geburt des Kindes bzw. mit der Vaterschaftsanerkennung für das Kind.
Will das Kind selbst die Vaterschaft anfechten, beginnt die Anfechtungsfrist mit dessen Volljährigkeit bzw. erst dann, wenn es von Tatsachen erfährt, die gegen eine Vaterschaft sprechen.
Die zweijährige Frist muss für eine Vaterschaftsanfechtung unbedingt eingehalten werden. Denn haben die Eltern diese versäumt, kann erst das volljährige Kind selbst die Vaterschaftsklage einreichen. Die Frist wird gehemmt, sobald das Familiengericht ein Verfahren zur Klärung der genetischen Abstammung mittels DNA-Test anordnet oder solange der zur Anfechtung Berechtigte z. B. durch Drohungen widerrechtlich an der Vaterschaftsanfechtung gehindert wird.
Beweise sammeln
Derjenige, der die Vaterschaft anfechten möchte, muss einwandfrei beweisen können, dass die Zweifel an der Vaterschaft berechtigt sind. Folgende Beweise kommen in diesem Zusammenhang infrage:
- ein DNA-Test, der die Vaterschaft des Anfechtenden widerlegt,
- ein Beweis für unehelichen Verkehr der Kindsmutter oder
- ein Beweis für die Zeugungsunfähigkeit des Vaters.
Den DNA-Test kann der vermeintliche Vater vorab selbst in Auftrag geben – dann benötigt er jedoch zwingend die Zustimmung von Mutter und Kind. Gibt er den DNA-Test eigenmächtig ohne Einwilligung in Auftrag, hat das Testergebnis keine Beweiskraft vor Gericht. Sollte die Mutter den Test verweigern, muss er andere Beweise vorlegen können, damit das Familiengericht den DNA-Test anlässlich der Vaterschaftsklage anordnet.
Belegt das Ergebnis des DNA-Tests, dass derjenige, der an der Vaterschaft für das Kind zweifelt, tatsächlich nicht dessen biologischer Vater ist, ist damit die Vaterschaft noch nicht aberkannt. Es muss Vaterschaftsanfechtungsklage beim Familiengericht eingereicht werden. Im Laufe des Verfahrens kann das Testergebnis dann als eindeutiges Indiz für die fälschlich angenommene Vaterschaft dienen.
Liegen ausreichende Beweise vor, um die Vaterschaft anzufechten, kann eine Vaterschaftsklage erhoben werden.
Ablauf der Vaterschaftsklage
Im Rahmen der Vaterschaftsanfechtung muss das Gericht klären, ob der rechtliche auch tatsächlich der biologische Vater des Kindes ist. Das Verfahren hierzu verläuft wie folgt:
- Klageeinreichung: Ob die Vaterschaft anfechtbar ist und somit Konsequenzen für Sorgerecht und Unterhaltspflichten gezogen werden müssen, muss das Familiengericht rechtsverbindlich entscheiden.
- Gerichtskostenvorschuss: Zur Durchführung des DNA-Tests kann das Familiengericht einen Kostenvorschuss vom Antragsteller fordern.
- Prüfung: Das Familiengericht wird zunächst die eingereichten Unterlagen auf deren Beweisfähigkeit prüfen und das Verfahren der Vaterschaftsklage einleiten.
- Anhörung der Beteiligten: Alle beteiligten Familienmitglieder werden vor Gericht angehört und um Stellungnahme zum Anliegen des Antragstellers gebeten. Das Gericht wird sich so ein Bild der familiären Beziehungen machen.
- DNA-Test: Wenn die Zweifel an der Vaterschaft berechtigt und die Voraussetzungen für die Vaterschaftsanfechtung erfüllt sind, es aber noch keinen DNA-Test gibt, wird das Gericht diesen zur Feststellung der Vaterschaft anordnen.
- Entscheidung: Auf Basis des Testergebnisses wird das Gericht verbindlich darüber entscheiden, wer Sorge- und Unterhaltspflicht für das Kind zu tragen hat.
Der Antrag zur Einleitung der Vaterschaftsanfechtung an das betreffende Familiengericht muss folgende Informationen enthalten:
✓ Benennung des zuständigen Gerichts,
✓ Namen und Adresse des Klägers sowie der anderen Beteiligten,
✓ Geburtsurkunde des Kindes/Abstammungszeugnis,
✓ Begründung der Klage,
✓ Beweise für zweifelhafte Vaterschaft des Klägers und
✓ Unterschrift des Klägers.
Ausführlichere Informationen zu den zivilrechtlichen Vorschriften für die Einreichung einer Klage, die auch für Klageverfahren vor dem Familiengericht gelten, finden Sie in unserem Beitrag zum Thema Klage einreichen.
4. Folgen der erfolgreichen Vaterschaftsanfechtung
Hat der DNA-Test eindeutig bewiesen, dass der Anfechtende nicht der biologische Vater des Kindes ist, hat dies sorge- und unterhaltsrechtliche Konsequenzen. Darüber hinaus kann der vermeintlich leibliche Vater einen Schadensersatzanspruch durchsetzen.
Neuregelung des Sorgerechts & Unterhalts
Wird durch die Vaterschaftsanfechtung festgestellt, dass der rechtliche Vater nicht der leibliche Vater des Kindes ist, wird das Vater-Kind-Verhältnis durch das rechtskräftige Urteil aufgehoben. Damit entfallen auch die Sorge- und Unterhaltspflicht des Anfechtenden. Ist ein Unterhaltstitel vorhanden, verliert dieser seine Gültigkeit. Das Urteil hat jedoch keine Auswirkungen auf das Umgangsrecht mit dem Kind.
Daraus folgt, dass zunächst die Mutter alleiniges Sorgerecht für das Kind erhält, solange der biologische Vater nicht bekannt oder nicht dazu bereit ist, die Vaterschaft anzuerkennen.
 Beitrag von
Beitrag von