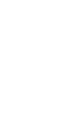10. Die Kosten einer Klage
Für die Klage muss der Kläger zunächst eine Vorauszahlung leisten. Erst wenn der sogenannte Gerichtskostenvorschuss bezahlt wurde, fängt das Gericht an zu arbeiten. Wer sich anwaltlich vertreten lässt, muss zusätzlich das Anwaltshonorar zahlen.
Wie hoch die Kosten für den Anwalt und das Gericht ausfallen, hängt vom Streitwert ab. Das Anwaltshonorar ist in der Gebührentabelle des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) festgelegt. Die Gerichtskosten sind im Gerichtskostengesetz (GKG) geregelt.
Die folgende Tabelle zeigt die Kosten exemplarisch für unterschiedliche Streitwerte. Sie gelten für Verfahren, die in der 1. Instanz mit einem Urteil beendet werden. Je nach Ausgang des Verfahrens (Beendigung mit Vergleich, Berufung) fallen die Prozesskosten unterschiedlich aus. Mögliche entstehende Kosten können Sie auch mit unserem Prozesskostenrechner ermitteln.
|
Streitwert in Euro
|
Gerichtskosten in Euro
|
Eigenes Anwaltshonorar in Euro*
|
|
500
|
114
|
169,58
|
|
1.000
|
174
|
285,60
|
|
5.000
|
483
|
1.017,45
|
|
10.000
|
798
|
1.850,45
|
|
50.000
|
1.803
|
3.828,83
|
|
200.000
|
5.763
|
6.625,33
|
* In der Beispielrechnung beinhaltet das Anwaltshonorar die außergerichtliche Tätigkeit, die Vertretung im Klageverfahren und die Mehrwertsteuer.
Wer zahlt den Rechtsanwalt?
Wenn Sie den Rechtsstreit vor Gericht gewinnen, muss in den meisten Fällen die Gegenseite alle entstandenen Kosten tragen: Die volle Gerichtsgebühr, alle Auslagen für Zeugen und Sachverständigengutachten und auch Ihre Anwaltskosten.
Ausnahmen:
- Kommt es zu einem Vergleich, handeln die Parteien aus, wer welche Prozesskosten trägt.
- Vor dem Arbeitsgericht zahlt jede Partei ihren Anwalt selbst.
Andersherum müssen Sie als Kläger sämtliche Prozesskosten inklusive der gegnerischen Anwaltsgebühren übernehmen, wenn Sie vor Gericht verlieren. Um das zu vermeiden, kann eine Rechtsberatung vor der Klageeinreichung sinnvoll sein. Ein Anwalt kann vorab die Erfolgsaussichten einschätzen. So können Sie einen möglicherweise aussichtslosen und teuren Rechtsstreit vermeiden.
Kostenübernahme durch die Rechtsschutzversicherung
In vielen Fällen übernimmt die Rechtsschutzversicherung einen Großteil der Kosten – bei einer Niederlage auch die Kosten der Gegenseite.
Die Versicherung zahlt aber nur, wenn Sie Ihnen vorab eine sogenannte Deckungszusage gegeben hat. Sie stellen dazu eine Deckungsanfrage bei Ihrem Versicherer. Dieser prüft dann, ob das Rechtsgebiet durch Ihre Police abgedeckt ist und ob überhaupt Erfolgsaussichten für das Verfahren bestehen.
Sie sind sich unsicher, ob Ihre Rechtsschutzversicherung die Kosten übernimmt? Ein advocado Partner-Anwalt stellt gern eine kostenlose Deckungsanfrage bei Ihrem Versicherer für Sie. Jetzt kostenlos prüfen lassen.
Finanzierung durch Prozesskostenhilfe
Wer finanziell nicht in der Lage ist, einen Prozess zu bezahlen, kann Prozesskostenhilfe beantragen. Der Kläger muss dazu seine Finanzen offenlegen. Anschließend prüft das Gericht, ob die wirtschaftlichen Voraussetzungen gegeben sind und ob die Klage Aussicht auf Erfolg hat.
Wird der Antrag bewilligt, übernimmt das Gericht alle Gerichtsgebühren und die eigenen Anwaltskosten – je nach der finanziellen Situation entweder als Vollzuschuss oder als Darlehen, das in Raten zurückzuzahlen ist.
Wer vom Sozialhilfesatz lebt und nicht mehr als 3.000 Euro Ersparnisse hat, muss die Prozesskostenhilfe nicht zurückzahlen. Nicht angerechnet wird eine selbst genutzte Immobilie. Kosten können dem Kläger aber auch mit Prozesskostenhilfe entstehen: Wer den Prozess verliert, muss das Anwaltshonorar der Gegenseite aus eigener Tasche bezahlen.
 Beitrag von
Beitrag von